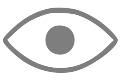Über 180 polizeiliche Maßnahmen gegen strafbare Hass-Botschaften, Beschuldigte vernommen, rechtes Spektrum dominiert, NRW führt 14 Verfahren.
Aktionstag gegen Hass und Hetze im Netz: Polizei durchsucht Dutzende Wohnungen

Während eines Aktionstages gegen Hass und Hetze im Netz wurden bundesweit Dutzende Wohnungen durchsucht und zahlreiche Verdächtige befragt. Laut Bundeskriminalamt (BKA) wurden über 180 polizeiliche Maßnahmen in mehr als 140 Ermittlungsverfahren gegen strafbare Hass-Botschaften eingeleitet. Mehr als 65 Durchsuchungsbeschlüsse wurden vollstreckt und zahlreiche Verdächtige vernommen.
Volksverhetzung und Beleidigung
Den Angeklagten wird unter anderem Volksverhetzung, die Beleidigung von Politikern und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen. In einigen Ermittlungsverfahren ging es um die Belohnung und Billigung von Straftaten. Laut BKA waren rund zwei Drittel der strafbaren Äußerungen dem rechten Spektrum zuzuordnen.
«Digitale Brandstifter» zur Rechenschaft ziehen
Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: «Digitale Brandstifter dürfen sich nicht hinter ihren Handys oder Computern verstecken können.» Der Minister sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Viele Menschen haben den Unterschied zwischen Hass und Meinung verlernt.»
In NRW werden 14 der Verfahren geführt, um die es bei dem Aktionstag geht. So soll ein Beschuldigter bei X (früher Twitter) geschrieben haben: «„Heil Hitler!! Nochmal. Wir sind Deutsche und eine erfolgreiche Nation. Männliche Ausländer raus.»
Mehr gemeldete Fälle
Der Aktionstag wurde zum zwölften Mal abgehalten. Das BKA, das die Koordination des Aktionstags zur Bekämpfung von strafbaren Hasspostings mit den Behörden der Länder übernimmt, verzeichnet seit Jahren einen deutlichen Anstieg der erfassten Fälle. Von 2021 bis 2024 (10.732 Fälle) hat sich die Anzahl der polizeibekannten Fälle mehr als vervierfacht. Laut BKA nimmt die Hetze einerseits tatsächlich zu, andererseits werden durch die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) jedoch auch immer mehr strafbare Inhalte aufgedeckt.
Das Bundeskriminalamt hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, Anzeige zu erstatten, wenn sie im Internet auf Hasspostings stoßen oder selbst Opfer von Online-Hetze geworden sind. Es sei auch wichtig, solche Beiträge den Anbietern sozialer Netzwerke zu melden und die Löschung strafbarer Inhalte zu verlangen.
Koalitionsvertrag sieht Änderungen vor
Da dies nicht immer einfach ist, hat sich die schwarz-rote Koalition das Ziel gesetzt, ein Digitales Gewaltschutzgesetz zu verabschieden. Dies soll die Rechte der Betroffenen stärken und die Sperrung von auch anonymen Hass-Accounts mit strafbaren Inhalten ermöglichen. Plattformen sollen Schnittstellen zu Strafverfolgungsbehörden bereitstellen, um relevante Daten automatisiert und schnell abrufen zu können.
Die «Meldestelle Respect!» sagte auf dpa-Anfrage, die Plattformen müssten dringend mehr Verantwortung übernehmen und konkrete Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Die in Berlin angesiedelte Organisation HateAid kritisierte, Plattformen wie X oder Facebook ignorierten Hinweise und Meldungen noch zu häufig.
Digitale Gewalt kann alle treffen
Digitale Gewalt «zieht sich durch alle Teile der Gesellschaft», betonte «Respect!». Aus Bildungsangeboten an Schulen wisse man, dass auch viele Jugendliche und junge Erwachsene nahezu täglich mit Hass und Hetze im Netz konfrontiert seien. «Viele von ihnen – sowohl Einzelpersonen als auch ganze Gruppen – fühlen sich im Umgang mit digitaler Gewalt alleingelassen und ohnmächtig.»
Die gemeldeten Inhalte seien nicht nur digital verletzend, sondern wirkten häufig auch in die Lebensrealitäten der Betroffenen hinein, berichtet die Meldestelle. Sozialarbeiterin Claudia Otte-Galle von der gemeinnützigen Organisation HateAid: «Es passiert selten, aber es passiert definitiv, dass digitale Gewalt in analoge Gewalt umschlägt.» Aus der Beratung kenne man schwerwiegende Fälle, in denen es zu nachhaltiger Rufschädigung gekommen sei, zu Depressionen oder Angststörungen, Betroffene hätten den Wohnort wechseln müssen. Das Bewusstsein für die Problematik sei aber gewachsen.