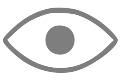Daten sicher auf deutschen Servern, Zugriff nur für Versicherte und autorisierte Personen, individuelle Einstellungen möglich.
Automatische E-Patientenakte für alle ab 2025

In Zukunft wird für alle gesetzlich Krankenversicherten, die nicht aktiv widersprechen, automatisch eine elektronische Patientenakte (ePA) angelegt. In dieser können nach und nach Arztbriefe und Befunde, Blutwerte, Medikationspläne, Zahnarztbehandlungen oder auch Informationen zur letzten Tetanus-Impfung hinterlegt werden. Was bezweckt man damit, wer trifft die Entscheidung über die gespeicherten Daten und welche Bedenken bestehen?
«Die elektronische Patientenakte wird dazu führen, dass die Versorgung besser wird. (…) ein System, was für Patienten, für Ärzte, aber auch für Forscher wichtige neue Möglichkeiten schafft.» (Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, am 30. September 2024)
Wo wird diese Akte angelegt und was wird darin gespeichert?
Die Akte und die enthaltenen Dokumente und Daten werden von den Verbraucherzentralen zentral auf Servern in Deutschland gespeichert und verschlüsselt. Die Anforderungen an die Datensicherheit sind sehr hoch. Technisch erfolgt dies über die Telematikinfrastruktur, ein geschlossenes Netzwerk, an das die Akteure des Gesundheitswesens angeschlossen sind. Laut Gesundheitsministerium können nur die Versicherten und diejenigen, die von ihnen autorisiert wurden, die Inhalte der E-Patientenakte einsehen. Die konkreten Informationen, die gespeichert werden, werden von den Versicherten selbst bestimmt – auch in Absprache mit ihren Ärzten.
Wie läuft das praktisch?
Über eine Smartphone-App der jeweiligen Krankenkasse können Versicherte Dokumente in ihrer Akte ablegen, wie zum Beispiel Befunde oder alte Laborergebnisse einscannen und hochladen. Auch selbst geführte Tagebücher mit Blutdruckmessungen können dort gespeichert werden. Beim Arztbesuch füllt der Arzt die Akte über seinen Praxis-Computer mit Befunden zu aktuellen Behandlungen. Zudem werden von den Krankenkassen abgerechnete Leistungen in die Akte hochgeladen. Dadurch wird transparent, wann welcher Arzt besucht wurde, welche Diagnose gestellt wurde und welches Medikament verschrieben wurde. Die E-Patientenakte für alle, die nicht widersprechen, startet ab Mitte Januar 2025.
Was soll das bringen?
Ein Beispiel: Rentner X zieht von der Stadt aufs Land, benötigt einen neuen Hausarzt und meldet sich in der neuen Praxis an. Seine Krankenkassenkarte wird in das Lesegerät gesteckt, wodurch die Praxis Zugriff auf seine elektronische Patientenakte erhält und der neue Arzt oder die neue Ärztin sehen können, welche Behandlungen X bereits erhalten hat oder welche Medikamente er einnimmt.
Es könnte auch im Notfall hilfreich sein, wenn X ins Krankenhaus müsste. Die Ärzte könnten in der E-Patientenakte Vorerkrankungen erkennen oder Wechselwirkungen bei der Verabreichung von Medikamenten besser ausschließen, wenn sie sehen, welche Arzneimittel X sonst regelmäßig nimmt.
Das heißt, sobald meine Krankenkassenkarte in ein Lesegerät eingesteckt wird, bin ich ein offenes Buch…
Je nach Einstellung in der App. Dort sollen Versicherte selbst festlegen können, welches Dokument für wen sichtbar ist. Das kann zum Beispiel über Vertraulichkeitsstufen laufen: Ein Dokument in der E-Akte wird entweder als freigegeben für alle markiert, die über das Stecken der Chipkarte Zugriff haben, oder es wird nur für bestimmte Ärzte freigegeben oder als gesperrt markiert, so dass nur der Patient selbst es sehen kann. «Sie können jederzeit Inhalte einsehen, einfügen, löschen oder verbergen, Zugriffsrechte erteilen oder beschränken und Widersprüche einlegen», heißt es bei den Verbraucherzentralen.
Welche Vorteile werden noch angeführt für die E-Patientenakte?
Transparenz und eine höhere Informiertheit der Patienten, da sie selbst Zugang zu ihren eigenen Gesundheitsdaten haben. Die Daten könnten auch helfen, Zweitmeinungen einzuholen oder gezieltere Fragen an den Arzt zu stellen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden könnten. Möglichkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden ebenfalls erwähnt.
«Zum Beispiel kann ich mit der KI über meine eigene elektronische Patientenakte sprechen. Sie kann mir Empfehlungen geben, und ich kann sie fragen, ob bei meiner Behandlung vielleicht Fehler gemacht worden sind». (Karl Lauterbach im November 2023 im «Spiegel»)
Aber wenn ich doch lieber beim Aktenordner bleibe und eine E-Akte nicht will?
Wer die E-Akte nicht möchte, muss bei der Krankenkasse aktiv dagegen Widerspruch einlegen, dann wird sie nicht eingerichtet. Es soll jedoch auch später möglich sein, eine bereits angelegte Akte zu löschen.
Es wird kritisiert, dass ältere oder technisch weniger versierte Menschen möglicherweise abgeschreckt werden könnten, die Akte über eine Smartphone-App zu steuern. Betroffene haben jedoch die Möglichkeit, eine vertrauenswürdige Person zu benennen, die sich um die technische Betreuung der Akte kümmert. Auch ohne eigenes Zutun bleibt die Akte bestehen, wenn nicht dagegen widersprochen wurde, und wird hauptsächlich von behandelnden Ärzten aktualisiert.
Sensible Gesundheitsdaten übers Handy und irgendwo zentral gespeichert – ist das nicht riskant?
Ein Risiko von Datenklau und Hackerangriffen besteht im digitalen Raum immer, somit bleibt die Nutzung solcher Technologien immer auch eine persönliche Abwägung. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) betont, die Datenverarbeitung in der E-Patientenakte erfolge «in einer auf höchstem Niveau sicherheitsgeprüften und vertrauenswürdigen technischen Umgebung». Auch die Apps seien «nach höchsten Standards sicherheitsgeprüft».
Die Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider kritisierte allerdings bei einer Diskussionsveranstaltung ihres Hauses kürzlich die Widerspruchslösung – also, dass alle automatisch eine E-Akte bekommen, sofern sie nicht widersprechen: Dies sei eine politische Entscheidung, aus datenschutzrechtlicher Sicht wäre man glücklicher mit einer Einwilligungslösung gewesen. «Dann hätten wir eine selbstbestimmte Entscheidung der Patienten gehabt und eine datenschutzrechtliche Legitimation, die in der breiten Bevölkerung auch akzeptiert worden wäre.»