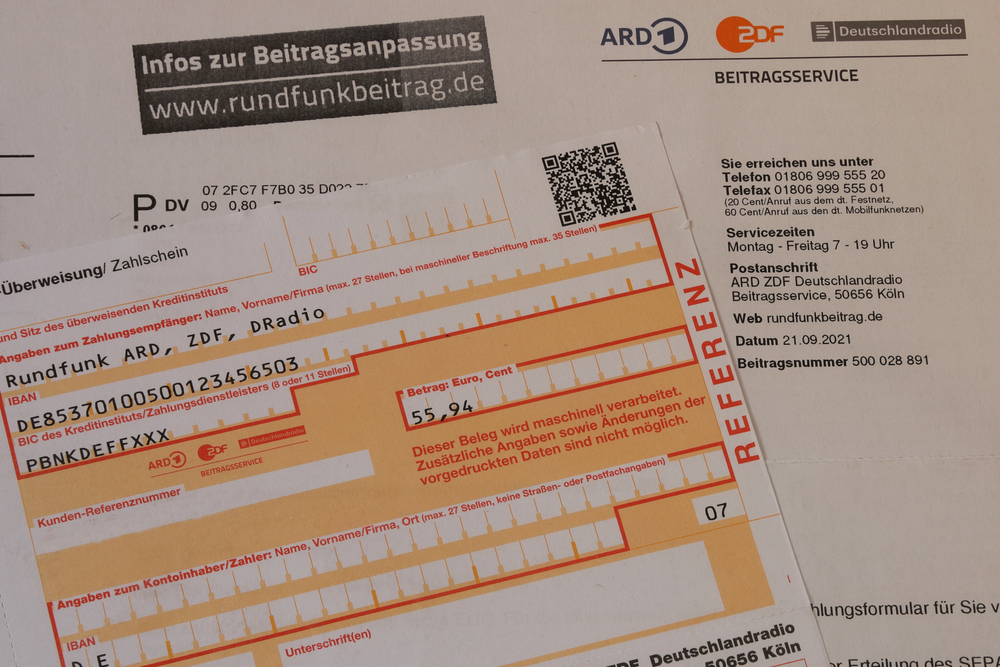16 Arbeitsgruppen mit 256 Unterhändlern sollen sich möglichst in zehn Tagen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm einigen. Kann das gut gehen?
Knackpunkte der Koalitionsverhandlungen

Migration, Finanzen, Bürgergeld: In den Sondierungsgesprächen haben sich Union und SPD bereits auf wichtige Punkte eines Regierungsprogramms geeinigt. Das zentrale Projekt ist jedoch inzwischen wieder unsicher geworden. Und viele Politikbereiche wurden noch nicht einmal berührt. Das sind die Herausforderungen für die Koalitionsverhandlungen, die heute unter extrem schwierigen Bedingungen beginnen.
– FINANZPAKET: Die Schuldenbremse wird für Verteidigungsausgaben gelockert und es wird ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen, vor allem in die Infrastruktur, geschaffen. Dieser Durchbruch in den Sondierungsgesprächen ist entscheidend. Allerdings haben die Grünen noch nicht zugestimmt, obwohl ihre Zustimmung im alten Bundestag erforderlich ist, um die notwendigen Grundgesetzänderungen durchzusetzen. Im neuen Bundestag wäre dies nur mit der AfD (ausgeschlossen) oder der Linken (extrem schwierig) möglich. Bisher blockieren die Grünen. Sollte bis zur geplanten Abstimmung im Bundestag am Dienstag keine Einigung erzielt werden, muss die Finanzfrage neu geklärt werden, um die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen zu schaffen. Im Grunde genommen müssten dann die gesamten Gespräche von vorne beginnen.
– MIGRATION: Auch die zweite große Grundsatzeinigung beim Thema Migration beinhaltet einen Fallstrick. Die Union hat zwar ihren Willen bekommen, dass auch Asylbewerber an den Grenzen zurückgewiesen werden sollen. Aber das soll nur «in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn» geschehen. Bei dieser Formulierung gibt es zwei unterschiedliche Lesarten. Die Union meint, man müsse die Nachbarn lediglich konsultieren. Die SPD hält eine Zustimmung für zwingend – und Österreich hat sich schon quer gestellt. Das kann in den weiteren Verhandlungen noch für Ärger sorgen.
– HAUSHALT: «Wir werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auch Einsparungen vornehmen», haben Union und SPD im Sondierungspapier vereinbart. Doch sie haben bewusst offen gelassen, welche Bereiche das betreffen soll. Sparen ist immer schmerzhaft, beide Seiten werden also um ihre Kernvorhaben kämpfen. Zu erwarten ist, dass die Union Sparrunden im Sozialetat vorschlagen wird, dem größten Bereich des Bundeshaushalts. Die SPD will am liebsten gar nicht so richtig sparen – und vor allem nicht bei der sozialen Absicherung. In den Koalitionsverhandlungen muss zumindest ein Grundkompromiss gefunden werden, den der neue Finanzminister dann in den Haushaltsverhandlungen umsetzen muss.
– VERTEIDIGUNG: In Anbetracht der wachsenden Bedrohung aus Russland und des drohenden Rückzugs der USA aus Europa wird die Verteidigungspolitik in den diesjährigen Koalitionsverhandlungen eine wichtigere Rolle spielen als zuvor. Die Union plant beispielsweise, die Ablehnung des scheidenden Kanzlers Olaf Scholz bezüglich der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine rückgängig zu machen. Außerdem unterstützt CDU-Chef Friedrich Merz im Gegensatz zu Scholz die Idee eines europäischen Nuklearschirms auf Basis französischer Atomwaffen. Die Union erwägt auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht, während die SPD weiterhin auf Freiwilligkeit setzt.
– Was passiert mit dem umstrittenen Erbe des Heizungsgesetzes der Ampel-Koalition? Die CDU hatte im Wahlkampf versprochen, es aufzuheben. Eine vollständige Rücknahme wird jedoch mit der SPD schwierig sein. Es wird wahrscheinlich eher um eine grundlegende Überarbeitung der von Verbänden kritisierten, detaillierten Regelungen gehen. Interessant wird sein, ob es Kürzungen bei der staatlichen Förderung des Heizungstauschs im Milliardenbereich geben wird.
– STEUERN: Es könnte eine Reform der Erbschaftsteuer bevorstehen – aber in welche Richtung? Die Union plant, Freibeträge zu erhöhen und die Erbschaftsteuer für Eigenheime zu senken. Die SPD strebt an, Unternehmensvermögen stärker zu besteuern. Sie plädiert auch für die Einführung einer Vermögensteuer, was die Union entschieden ablehnt. Auch über die Zukunft des Solidaritätszuschlags ist noch unklar: Die Union strebt dessen vollständige Abschaffung an, die SPD bisher nicht.
KLIMAGELD: Trotz der steigenden CO2-Bepreisung beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien wird in der politischen Debatte schon lange über ein Klimageld diskutiert. Im Sondierungspapier von Union und SPD findet sich jedoch keine Erwähnung davon. Die Einführung eines Klimageldes würde voraussichtlich hohe Kosten verursachen, weshalb Union und SPD Entlastungen bei den Energiekosten versprochen haben.
– Die Union plant, den bundeseigenen Bahn-Konzern umzustrukturieren und den Infrastruktur- und Transportbereich voneinander zu trennen, um mehr Wettbewerb zu schaffen. Die SPD hat dies bisher abgelehnt. Besonders die CSU kritisiert auch das Konzept einer milliardenteuren Generalsanierung stark belasteter Strecken, da kleinere Strecken nicht berücksichtigt werden.
– Die Finanzierung des deutschlandweit gültigen Deutschlandtickets im Nah- und Regionalverkehr ist nur noch bis Ende des Jahres gesichert, da bis dahin nur ein Bundeszuschuss festgelegt ist. Vor allem die CSU betrachtet die Bundesmittel kritisch. Sollte das Ticket fortgeführt werden, könnte der Monatspreis von derzeit 58 Euro steigen.