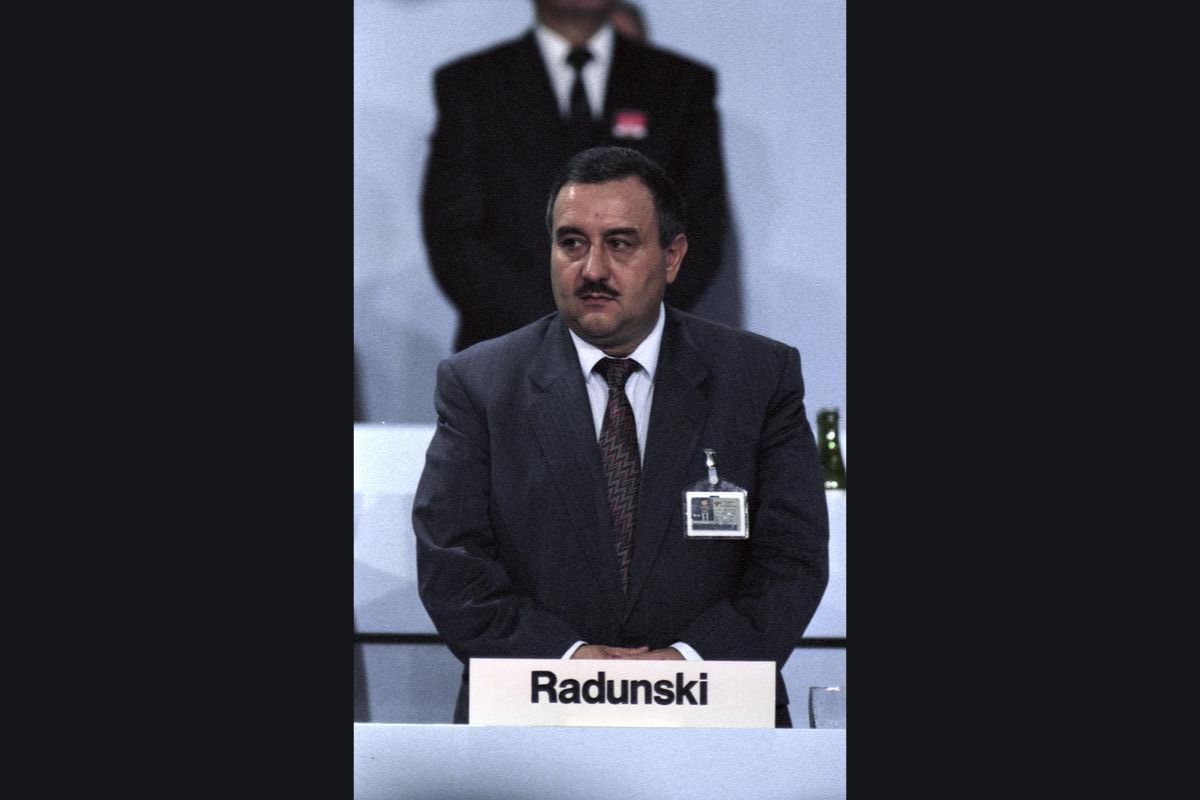Mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen warten auf eine Neuregelung ihrer Einkommen und Arbeitszeiten. Jetzt gibt es eine Schlichtungsempfehlung.
Öffentlicher Dienst: Schlichter für mehr Geld in zwei Stufen

Die Schlichter im Tarifstreit des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen schlagen vor, die Einkommen in zwei Schritten zu erhöhen: Ab dem 1. April 2025 soll es eine Steigerung um drei Prozent geben, jedoch mindestens 110 Euro mehr pro Monat. Ab dem 1. Mai 2026 soll dann eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent erfolgen. Diese Informationen wurden von der Schlichtungskommission unter der Leitung des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) und des ehemaligen Bremer Staatsrats Hans-Henning Lühr bekannt gegeben.
Die Tarifverhandlungen für die über 2,5 Millionen Beschäftigten in wichtigen Berufen von der Kita bis zur Müllabfuhr sind nach drei Verhandlungsrunden am 17. März gescheitert. Daher müssen die Schlichter eine Lösung finden. Dies soll am 5. April erneut von den Tarifpartnern verhandelt werden.
27 Monate Laufzeit
Der Vorschlag beinhaltet weitere Details. Laut diesem soll der neue Tarifvertrag 27 Monate dauern. Die Jahressonderzahlung für die Beschäftigten soll ab dem Jahr 2026 angehoben werden. Außerdem sollen Mitarbeiter außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen die Möglichkeit haben, Teile der Jahressonderzahlung in freie Tage umzuwandeln. Ab dem Jahr 2027 sollen sie gemäß dem Schlichtervorschlag einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten.
Ab dem Jahr 2026 wird es möglich sein, die wöchentliche Arbeitszeit freiwillig auf bis zu 42 Stunden zu erhöhen. Außerdem wird von den Schlichtern empfohlen, die Regelungen zu Langzeitkonten, Gleitzeit und Arbeitszeit von Rettungsdiensten zu verbessern.
Die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund organisierten während des Tarifstreits wiederholt Warnstreiks, die Hunderttausende Menschen im Alltag beeinträchtigten, beispielsweise in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und an Flughäfen.
Ursprünglich acht Prozent mehr gefordert
Die Gewerkschaften forderten ursprünglich acht Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 350 Euro mehr pro Monat sowie mindestens drei zusätzliche freie Tage pro Jahr. Die Arbeitgeberseite – die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA und das Bundesinnenministerium – bezeichnete diese Forderungen als nicht finanzierbar.
Die Arbeitgeber boten während der Verhandlungen angeblich an, die Entgelte um 5,5 Prozent zu erhöhen sowie ein höheres 13. Monatsgehalt und höhere Schichtzulagen anzubieten. Die Laufzeit war noch unklar. Dies war den Gewerkschaften jedoch nicht genug, sie waren jedoch bereit, weiter zu verhandeln.
Schließlich rief die Arbeitgeberseite die Schlichtung an, weil die Gewerkschaften sich zu wenig bewegt hätten. Nach dem letzten Verhandlungsstand erwartete VKA-Präsidentin Karin Welge Kosten von 15 Milliarden Euro verteilt auf zwei Jahre.
Die 26-köpfige Schlichtungskommission unter dem Vorsitz von Koch und Lühr hatte seit Montag an einem unbekannten Ort getagt. Koch kam die Rolle des «stimmberechtigten Schlichters» zu, der im Streitfall den Ausschlag gibt. Auf der Basis ihrer Empfehlung verhandeln nun erneut die Tarifparteien. Voraussichtlich passiert dies am 5. April. Während der Schlichtung gibt es in diesem Tarifkonflikt keine Warnstreiks.