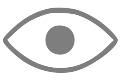Von der Ukraine bis Nahost: US-Präsident Trump will als Friedensstifter in die Geschichte eingehen. Der Republikaner begehrt, was sein demokratischer Vorgänger Obama schon hat: den Friedensnobelpreis.
«Präsident des Friedens»? Trump strebt nach Vermächtnis

«Ich bin stolz, der Präsident des FRIEDENS zu sein!»: Mit diesen Worten kommentiert US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass zwischen Thailand und Kambodscha eine Waffenruhe vereinbart wurde – ihm zufolge, nachdem er eingegriffen hat. Er habe nun viele Kriege in nur sechs Monaten beendet. «Glückwunsch an alle!», schreibt der Republikaner dazu.
Am meisten beglückwünscht er dabei wohl sich selbst. Denn für ihn stützt die jüngste Einigung das Bild, das er von sich selbst zeichnen möchte. Spricht er über seine Außenpolitik, bringt er regelmäßig den Friedensnobelpreis ins Spiel. «Ich verdiene ihn, aber sie werden ihn mir nie geben», sagt er etwa bei einem Besuch von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Februar.
Einige Monate später kehrt Israels Regierungschef nach Washington zurück und informiert seinen Amtskollegen, dass er ihn für den Preis nominiert hat. Dies ist nicht Trumps erste Nominierung – und Netanjahu ist auch nicht der einzige Politiker, der erkannt hat, dass er damit beim US-Präsidenten punkten kann.
Schon in seiner ersten Amtszeit gab sich Trump überzeugt, er würde die Auszeichnung «für viele Sachen» bekommen, wenn sie denn nur fair vergeben werden würde. Woher rührt seine Ambition auf den Preis, die mehrere US-Medien als «Obsession» bezeichnen?
Trump wünscht sich Vermächtnis eines Friedensstifters
Als Trump bei seiner zweiten Amtseinführung im Januar ans Mikrofon trat, sagte er unter anderem Folgendes: «Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir gar nicht erst geraten.» Mit Blick auf seine eigene Rolle fügte er hinzu: «Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Versöhners sein.»
Rivalität mit Ex-Präsident Obama
Trumps selbsterklärter Wunsch, als Friedensstifter in die Geschichte einzugehen, dürfte allerdings nicht sein einziger Antrieb sein. Sein ehemaliger Berater John Bolton schrieb vor einigen Wochen auf der Plattform X: «Trump will einen Friedensnobelpreis, weil Barack Obama einen bekommen hat.»
Tatsächlich thematisierte Trump die Auszeichnung des früheren Präsidenten etwa bei einem Auftritt in Las Vegas im Oktober 2024, kurz bevor er die Präsidentschaftswahl zum zweiten Mal gewann. «Sie haben Obama den Nobelpreis verliehen. Er wusste nicht einmal, warum zum Teufel er ihn bekommen hat, oder?», sagte Trump über den Mann, den er 2017 als US-Präsident ablöste. «Er wurde gewählt und sie gaben bekannt, dass er den Nobelpreis bekommt.»
Trump griff damit eine alte Kritik an der kontroversen Verleihung des Preises an Obama auf. Der Demokrat erhielt die Auszeichnung bereits zu einem frühen Zeitpunkt seiner Präsidentschaft, als er erst einige Monate im Amt war. Die Verleihung wurde mit seinem Einsatz zur Stärkung der internationalen Diplomatie und der Kooperation zwischen den Völkern begründet. Wofür glaubt Trump, die Auszeichnung verdient zu haben?
Lange Liste an Konflikten
Vor ein paar Wochen listete er in einem Post auf der Plattform Truth Social gleich mehrere Konflikte auf der Welt auf, in denen er vermittelt habe. Das Wort «Friedensnobelpreis» fällt dabei sechsmal. Nummer eins der Aufzählung ist das Friedensabkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda. Es kam unter Vermittlung der USA zustande und wurde jüngst in Washington unterzeichnet.
«Ich werde dafür keinen Friedensnobelpreis bekommen», schrieb der Präsident. Dasselbe gelte etwa auch für den Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan, in dem Trump nach eigener Darstellung eine Waffenruhe vermittelt hat. Pakistan kündigte an, ihn wegen seiner Vermittlerrolle für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen – Indien bestritt dagegen, dass die USA vermittelt hätten. So oder so – Trumps Auflistung ist damit nicht zu Ende.
Erst Waffeneinsatz, dann Waffenruhe – Rolle der USA im Iran
«Nein, ich werde keinen Friedensnobelpreis bekommen, egal, was ich tue, Russland/Ukraine eingeschlossen und Israel/Iran, was auch immer diese Ergebnisse sein mögen», schrieb er weiter. Nur einen Tag später folgte ein Post, den die Welt noch lange in Erinnerung haben dürfte: Die USA haben die drei wichtigsten iranischen Atomanlagen angriffen, erklärt Trump und ergänzt: «JETZT IST DIE ZEIT FÜR FRIEDEN!».
Mit dem Einsatz «Mitternachtshammer» beteiligten sich die USA aktiv an dem Krieg: US-Tarnkappenbomber warfen insgesamt 14 bunkerbrechende Bomben auf iranische Anlagen ab. War in den Stunden danach unklar, wohin das führen wird, so verkündete Trump bald darauf eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran.
Der republikanische Abgeordnete Buddy Carter erklärte, dass er seinen Parteikollegen wegen dessen Rolle bei der Vermittlung eines Endes des zwölf Tage dauernden Krieges für den Friedensnobelpreis nominiert hat. Der US-Präsident hat außerdem dafür gesorgt, dass der Iran nicht in der Lage ist, eine Atomwaffe zu erhalten.
Das genaue Ausmaß der Schäden an den Atomanlagen ist jedoch bis heute nicht geklärt. Rechtsexperten im Völkerrecht betrachteten den Angriff der USA und Israels als unrechtmäßig.
Kein Frieden im Nahen Osten und der Ukraine
Einige betrachten einen Verdienst von Trump aus seiner ersten Amtszeit als historischen Durchbruch: die sogenannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten. Der Republikaner brachte sie 2020 auf den Weg. Ein norwegischer Politiker nominierte ihn deshalb bereits damals für den Friedensnobelpreis. In einem Post vor einigen Wochen schrieb Trump, dass, wenn alles gut gehe, die Abkommen von weiteren Ländern unterzeichnet werden würden und den Nahen Osten vereinen.
Noch ist die Region allerdings weit entfernt von Frieden. Die USA vermitteln seit längerem im Gaza-Krieg – doch selbst das Ringen um eine zeitlich begrenzte Waffenruhe gestaltet sich als schwierig. Nicht vergessen ist zudem Trumps umstrittener Vorschlag für die Zukunft des Gazastreifens: Er wolle das Küstengebiet unter Kontrolle der USA in eine wirtschaftlich florierende «Riviera des Nahen Ostens» verwandeln, erklärte er, und sprach davon, die dort lebenden Palästinenser dafür in arabische Staaten der Region «umzusiedeln». Eine Zwangsumsiedlung würde Experten zufolge gegen das Völkerrecht verstoßen.
Und dann gibt es noch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Trump hatte vor seinem Wahlsieg mehrmals behauptet, er könne den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Seit seinem Amtsantritt hat er mehrmals mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Doch dieser lässt das Nachbarland weiterhin massiv angreifen – und Trump wird kritisiert, nicht genug Druck auf den Kremlchef auszuüben.
Der US-Präsident schien kürzlich sowohl mit Putin als auch mit Netanjahu die Geduld zu verlieren: Er drängte auf Lebensmittellieferungen in den Gazastreifen und verkürzte eine Frist, nach deren Ablauf Handelspartner Russlands mit Sanktionen rechnen müssten. Doch gerade Trumps Handelspolitik zeigt, wie sprunghaft sein Einsatz von Druckmitteln ausfallen kann. Heute droht er – morgen rudert er womöglich schon wieder zurück. So bleibt wohl auch zu sehen, ob er nachhaltigen Frieden schaffen kann – und keinen auf Zeit.