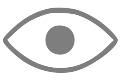Per Dekret hat Trump versucht, das US-Geburtsrecht zu beschneiden. Gerichte stoppten ihn zunächst. Nun hat der Supreme Court entschieden, ob sie das in diesem Ausmaß dürfen.
Streit um Geburtsrecht: Sieg für Trump vor Oberstem Gericht

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um das Geburtsrecht in den USA einen Sieg vor dem Supreme Court erzielt. Das Oberste Gericht entschied, die Anordnungen von Bundesrichtern teilweise auszusetzen, die ein Dekret Trumps vorläufig in den gesamten USA gestoppt hatten. Solche landesweiten Stopps überschritten wahrscheinlich die Befugnisse der unteren Instanzen, hieß es zur Begründung. Im Fokus der Entscheidung stand also nicht die Verfassungsmäßigkeit des Dekrets. Trump sprach von einem «monumentalen Sieg».
Gemäß dem 14. Verfassungszusatz der USA gilt das Geburtsortsprinzip: Alle Personen, die auf US-amerikanischem Boden geboren werden und der amerikanischen Gerichtsbarkeit unterliegen, werden automatisch Staatsbürger – unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern.
Worauf Trump abzielt – und was Gerichte vorläufig anordneten
Trump stellt dieses Prinzip in Frage. Unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hatte er ein Dekret unterzeichnet, das bestimmten Neugeborenen die Staatsbürgerschaft verweigern soll. Betroffen sind Kinder, deren Mütter bei der Geburt keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hatten oder sich nur vorübergehend legal in den USA aufhielten – zum Beispiel Touristinnen oder Studentinnen. Voraussetzung ist auch, dass der Vater weder US-Bürger ist noch eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hat.
Nachdem mehrere Bundesstaaten und Bürgerrechtsorganisationen dagegen geklagt hatten, haben einige Bundesgerichte Trumps Dekret per einstweiliger Verfügung landesweit außer Kraft gesetzt. Diese vorläufigen Anordnungen sollen sicherstellen, dass das möglicherweise verfassungswidrige Dekret nicht in Kraft tritt, während die Klagen noch anhängig sind. Sie ersetzen kein endgültiges Urteil.
Die Regierung argumentierte daraufhin, dass vorläufige Anordnungen mit landesweiten Auswirkungen die Fähigkeit der Exekutive einschränkten, ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie forderte, dass solche Stopps durch Bundesgerichte nur für direkt beteiligte Kläger gelten und nicht landesweit. Dem folgten die Richterinnen und Richter nun. Geklagt hatten unter anderem 22 Bundesstaaten. In den anderen 28 Bundesstaaten könnte das Dekret der «New York Times» zufolge in 30 Tagen in Kraft treten.
Wie viel Handlungsspielraum sollen Gerichte haben?
In der Vergangenheit gab es bereits Streit über weitreichende Eingriffe unterer Gerichte – auch unter Trumps demokratischem Vorgänger im Amt, Joe Biden.
Befürworter der Möglichkeit, landesweite Dekrete zu stoppen, argumentieren, dass selbst offensichtlich verfassungswidrige Maßnahmen ohne diese Option zumindest vorübergehend umgesetzt werden könnten. Sie warnen auch vor einem rechtlichen Flickenteppich, in dem unterschiedliche Regeln je nach Bundesstaat gelten könnten.
Laut US-Medien könnte die Entscheidung des Supreme Courts über den aktuellen Fall hinaus weitreichende Auswirkungen haben. Trump nutzt seine exekutiven Befugnisse umfangreich und wird oft von Richtern gestoppt.
Der Republikaner betonte im Weißen Haus, dass die Regierung nun zahlreiche Maßnahmen vorantreiben könne, die zuvor zu Unrecht von Richtern blockiert worden seien. Auch Justizministerin Pam Bondi sieht den Beschluss als positives Signal für die Regierung. Richter hatten Trumps Politik – von Zöllen über das Militär bis hin zur Einwanderung – blockiert.
Das Oberste Gericht hat sich während der ersten Amtszeit von Trump durch mehrere Nachbesetzungen politisch nach rechts bewegt. Von den insgesamt neun Richtern gelten sechs als konservativ und nur drei als liberal. Die heutige Entscheidung fiel entlang dieser Linie mit sechs zu drei.