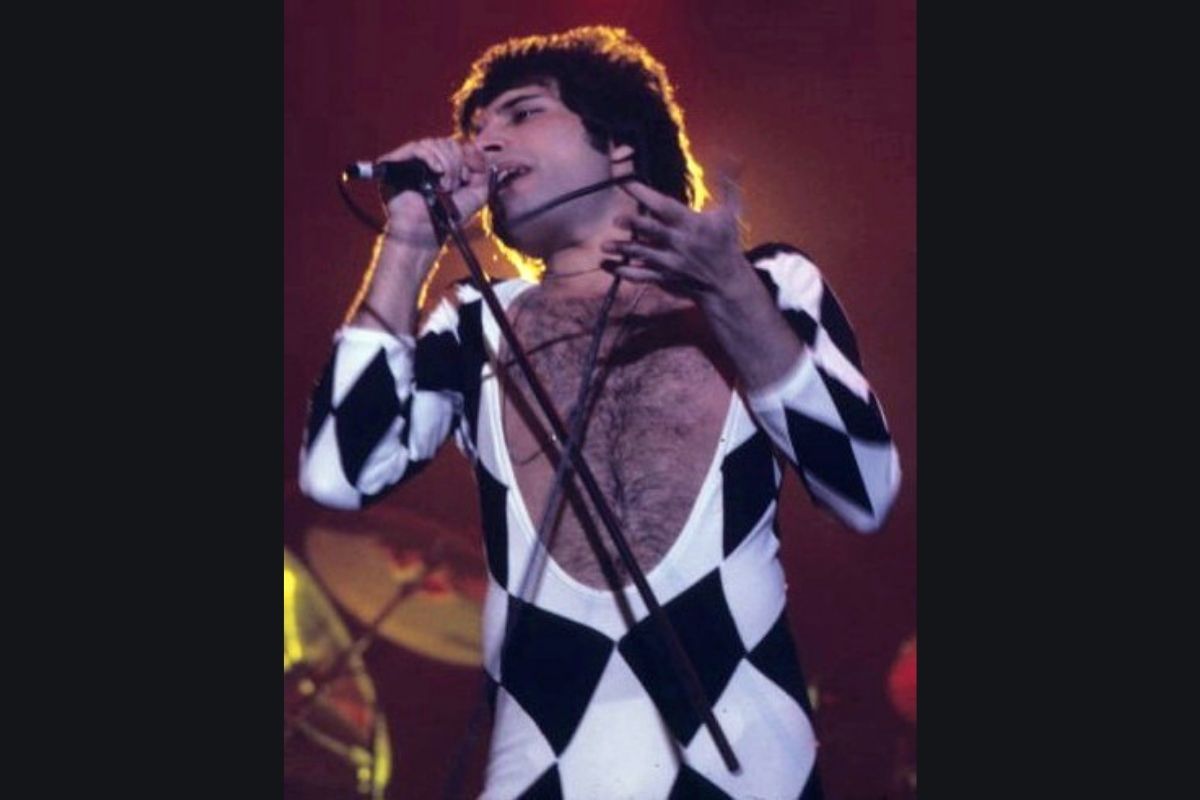Firmen können Ausgaben für Maschinen und Elektrofahrzeuge steuerlich abschreiben, um Investitionen anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern.
Milliardenschwere Steuerentlastungen für die Wirtschaft beschlossen

Der Bundestag entscheidet heute über milliardenschwere Steuerentlastungen, die der Wirtschaft aus ihrer Krise helfen sollen. Erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen und Elektrofahrzeuge sollen sicherstellen, dass Firmen wieder mehr investieren. Der sogenannte Wachstumsbooster soll auch Arbeitsplätze sichern – für die Bundesregierung wird er allerdings teuer.
Die Ankurbelung der schwachen Wirtschaft ist für die schwarz-rote Koalition trotzdem eins der dringendsten Themen. Deutschland läuft Gefahr, das dritte Jahr in Folge ohne Wirtschaftswachstum zu erleben.
Was ist genau geplant?
Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Investitionen in Maschinen und Geräte über die nächsten zwei Jahre degressiv von der Steuer abzusetzen – und zwar mit einem Satz von bis zu 30 Prozent. Dadurch verringert sich unmittelbar nach dem Kauf der Gewinn in der Buchhaltung und somit die Steuerlast. Dieser Effekt ist jedoch zeitlich begrenzt: Anfangs sind die Abschreibungen höher, danach sinken sie im Laufe der Zeit.
Nach dem Auslaufen des sogenannten Boosters soll die Körperschaftsteuer ab 2028 schrittweise von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent im Jahr 2032 gesenkt werden. Der Kauf eines reinen Elektroautos wird für Unternehmen ebenfalls steuerlich attraktiver. Unternehmen, die ein neues betrieblich genutztes E-Auto erwerben, können im Kaufjahr 75 Prozent der Kosten steuerlich abschreiben. Dadurch sollen auch kleine Betriebe wie Handwerker E-Autos erschwinglicher machen und der deutschen Autoindustrie einen Schub geben.
Wie hilft das den Firmen?
Experten sind der Meinung, dass deutsche Unternehmen zu wenig in ihre Zukunft investieren – dabei könnten modernere Maschinen helfen, mehr und besser zu produzieren. Die degressive Abschreibung entlastet nun besonders in der unmittelbaren Phase nach einer Investition. Firmen haben dadurch schneller wieder mehr Geld zur Verfügung.
Das Dilemma: Die Maßnahme ist nur für Unternehmen wirksam, die von Anfang an genug Geld für den Erwerb von Maschinen und Geräten haben. Außerdem zögern viele Unternehmen aufgrund der volatilen internationalen Lage und der unberechenbaren Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, in Investitionen zu tätigen – und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern.
Viele Firmen konzentrieren sich hauptsächlich auf eine Senkung der Körperschaftsteuer. Sie erhoffen sich dadurch eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, da Unternehmen hierzulande bisher im internationalen Vergleich relativ hohe Steuern zahlen.
Warum gab es Zoff mit den Ländern?
Steuersenkungen führen in den öffentlichen Haushalten zu weniger Einnahmen. Beim «Wachstumsbooster» geht es dabei um rund 48 Milliarden Euro. Die sollten ursprünglich zu großen Teilen auch von Ländern und Kommunen getragen werden. Konkreter: Den Kommunen drohten Einnahmeverluste von 13,5 Milliarden Euro, den Ländern von 16,6 Milliarden, der Bund sollte 18,3 Milliarden Euro schultern.
Die Länder forderten daher einen finanziellen Ausgleich, insbesondere für die teilweise hoch verschuldeten Kommunen. Sie drohten damit, das Paket am 11. Juli im Bundesrat scheitern zu lassen.
Welche Lösung wurde gefunden?
Der Staat übernimmt die Steuerausfälle der Städte und Gemeinden vollständig – bis zum Jahr 2029. Da die Bundesregierung nicht direkt Geld an die Länder überweisen kann, geschieht dies über die Verteilung der Mehrwertsteuer-Einnahmen.
Um die Länder zu unterstützen, plant der Bund, zwischen 2026 und 2029 zusätzliche acht Milliarden Euro in Kitas, andere Bildungseinrichtungen und moderne Krankenhäuser zu investieren. Dadurch sollen etwa die Hälfte der Steuerausfälle der Länder kompensiert werden. Es wird erwartet, dass das Gesetz nach der Verabschiedung im Bundestag im Juli auch den Bundesrat ohne größere Probleme passieren wird.