Ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt offen, wie unausgewogen die klinische Krebsforschung verteilt ist. Während in Europa, Nordamerika und Teilen Ostasiens zahlreiche Studien laufen, gibt es in 63 Staaten überhaupt keine registrierten Krebsstudien. Besonders erschreckend: Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, in denen ein großer Teil der weltweiten Krebsfälle auftreten, werden von der Forschung […]
Globale Krebsforschung: WHO-Bericht zeigt große Lücken in ärmeren Ländern
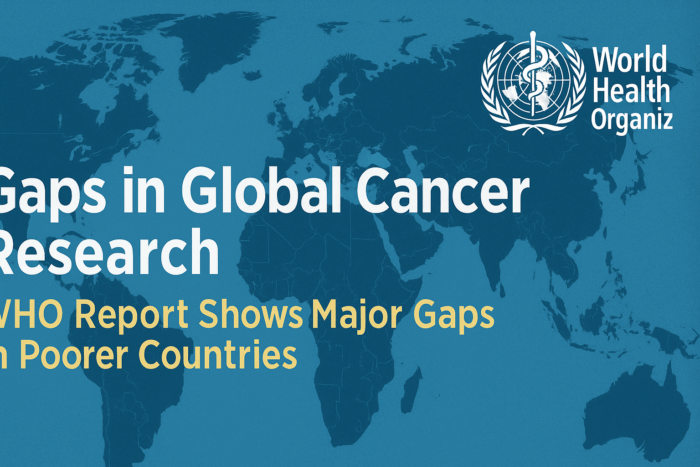
Ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt offen, wie unausgewogen die klinische Krebsforschung verteilt ist. Während in Europa, Nordamerika und Teilen Ostasiens zahlreiche Studien laufen, gibt es in 63 Staaten überhaupt keine registrierten Krebsstudien. Besonders erschreckend: Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, in denen ein großer Teil der weltweiten Krebsfälle auftreten, werden von der Forschung oft komplett ignoriert. Der Bericht wertet mehr als 120 000 registrierte Studien aus und zeigt, dass die meisten Initiativen auf Hochschulen und Kliniken in reichen Ländern entfallen.
Die WHO kritisiert, dass diese ungleiche Verteilung den Zugang zu neuen Behandlungsoptionen einschränkt. Millionen von Menschen haben keine Möglichkeit, an klinischen Studien teilzunehmen und von modernsten Therapien zu profitieren. Damit entsteht ein Kreislauf: Ohne Daten aus diesen Ländern bleiben Bedürfnisse verborgen, wodurch wiederum weniger Forschung dort stattfindet.
Krebsarten mit den höchsten Todesraten vernachlässigt
Besonders problematisch ist, dass die Krebsarten, die in ärmeren Regionen am häufigsten tödlich verlaufen, deutlich unterrepräsentiert sind. Der WHO-Bericht weist darauf hin, dass Leber‑, Gebärmutterhals‑ und Magenkrebs – drei Erkrankungen, die in vielen Schwellenländern zu den häufigsten Todesursachen gehören – deutlich weniger klinische Studien erhalten als Brust- oder Lungenkrebs. Weltweit sterben jedes Jahr Hunderttausende Menschen an diesen vermeidbaren oder behandelbaren Tumoren, doch die klinische Forschung konzentriert sich weiterhin auf Erkrankungen, die in reichen Ländern verbreiteter sind.
Auch die Forschungsschwerpunkte spiegeln eher wirtschaftliche Interessen als öffentliche Gesundheitsbedürfnisse wider. Die Landschaftsanalyse zeigt, dass sich die meisten Studien mit neuen Medikamenten beschäftigen. Chirurgische Verfahren, Bestrahlung, Diagnostik und Palliativversorgung spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Dabei sind gerade Operationen und Strahlentherapie in vielen Ländern die einzigen verfügbaren Optionen – vorausgesetzt, es gibt überhaupt Zugang.
Fokus auf Medikamente statt breiter Versorgung
Laut WHO überwiegen Arzneimittelstudien den Rest deutlich: Mehr als zwei Drittel der über 120 000 erfassten Studien befassen sich mit der Erforschung neuer Wirkstoffe oder Kombinationstherapien. Forschung zu Früherkennung, chirurgischen Techniken und Strahlentherapie macht dagegen weniger als zehn Prozent aus. Doch ohne Innovationen bei Diagnostik und Versorgung können Millionen Patientinnen und Patienten nicht von frühen Diagnosen und lebensrettenden Operationen profitieren. Die einseitige Fokussierung führt dazu, dass grundlegende Versorgungsstrukturen vielerorts fehlen.
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Finanzierung von Unterstützungsangeboten. Palliativmedizin und psychosoziale Betreuung, die das Leiden von Betroffenen lindern, kommen in der Studienlandschaft kaum vor. Für Länder, in denen die Therapie erst spät beginnt und Heilungschancen gering sind, ist dies jedoch besonders wichtig. Die WHO fordert deshalb, den Forschungsschwerpunkt stärker auf ganzheitliche Ansätze zu lenken.
Forderungen und Empfehlungen
Die Autorinnen und Autoren des Berichts betonen, dass die globale Krebsforschung künftig stärker an den realen Krankheitslasten ausgerichtet werden muss. Forschungsgelder sollten nicht nur in neue Medikamente, sondern auch in Programme zur Früherkennung, Prävention und Versorgung fließen. Dazu gehört auch, Forschungskapazitäten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen aufzubauen, damit lokale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drängende Fragen untersuchen können.
Die WHO schlägt vor, internationale Partnerschaften zu stärken, um Know-how und Ressourcen zu teilen. Staaten und Stiftungen sollten bei der Priorisierung ihrer Mittel berücksichtigen, welche Krebsarten in ihrer Region die meisten Todesfälle verursachen. Ohne diese Neuorientierung droht die wissenschaftliche Kluft noch größer zu werden.
Ein Beispiel für fehlende Zusammenarbeit sind große klinische Studien, die überwiegend in wohlhabenden Ländern rekrutieren. Wenn Menschen aus Ländern ohne Forschungsinfrastruktur teilnehmen wollen, müssen sie oft weite Strecken reisen und viel Geld investieren – oder sie sind ausgeschlossen.
Fazit
Der WHO-Bericht macht deutlich, dass die globale Krebsforschung dringend ausgewogener werden muss. In 63 Ländern gibt es noch immer keine einzige registrierte Studie. Wenn Forschung und klinische Studien weiterhin vor allem in reichen Ländern stattfinden, droht sich die Ungleichheit zu verschärfen. Um die globale Krebslast zu senken, müssen Forschungsgelder breiter verteilt, Versorgungswege verbessert und die Bedürfnisse ärmerer Regionen stärker berücksichtigt werden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass jeder Patient – unabhängig von seinem Wohnort – von den Fortschritten der Wissenschaft profitieren kann.









