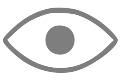Tim Meyer hört nach 21 Jahren als Nationalmannschaftsarzt auf. Der 55-Jährige erlebte in Katar sein sechstes WM-Turnier. Er hat viel erlebt mit vier Bundestrainern – und am Ende eine Pandemie.
DFB-Arzt Tim Meyer: «Corona war die belastendste Zeit»

Hansi Flick muss sich einen neuen Arzt suchen – zumindest bei der Fußball-Nationalmannschaft. Denn Tim Meyer beendet nach der WM in Katar seine Tätigkeit als Teamarzt nach 21 Jahren.
Der Entschluss stand für den 55-Jährigen schon vor dem Turnier fest, wie Meyer im Interview der Deutschen Presse-Agentur zu seinen Beweggründen, seinen vielfältigen Turniererlebnissen und der Zusammenarbeit mit insgesamt vier Bundestrainern inklusive Flick erzählt.
Frage: Nach mehr als zwei Jahrzehnten hören Sie als Arzt der Fußball-Nationalmannschaft auf. Was sind Ihre Beweggründe?
Antwort: Eigentlich sind es die 21 Jahre. Irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man sich vorstellen kann, andere Sachen zu machen als an den Spielfeldrand zu sprinten und Fußballern die Wasserflasche zu reichen. Nach sechs Weltmeisterschaften habe ich auch schon sehr viel gesehen. Da stellt sich einem zwangsläufig die Frage: Was kommt noch? Ich hatte schon länger über diesen Schritt nachgedacht.
Frage: War das nächste sportlich enttäuschend verlaufene Turnier in Katar also maximal der letzte Anstoß?
Antwort: Nein, gar nicht. Ich habe es vor der WM schon gewusst, aber nur im engsten Umfeld, mit meiner Frau und mit wenigen guten Freunden, besprochen. In das Turnier bin ich in dem Wissen gegangen, dass ich danach als Mannschaftsarzt aufhören würde.
Frage: Und nach dem Aus haben Sie dann zeitnah den Bundestrainer und den DFB informiert?
Antwort: Ich habe zunächst Hansi Flick und Oliver Bierhoff gleich auf dem Rückflug aus Katar informiert. Das war aber nur ganz kurz, weil ja doch andere Dinge für die beiden im Vordergrund standen, sodass der Bundestrainer und ich ein paar Tage später noch einmal telefoniert haben. Andere Personen habe ich dann mündlich informiert, aber manche haben es bestimmt erst über die Pressemitteilung erfahren.
Frage: Sie haben die Heim-WM 2006 erlebt, die sicherlich ein emotionales Highlight in Ihrer Amtszeit war. Warum wollten Sie sich nicht noch die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr gönnen?
Antwort: Dieses WM-Erlebnis im eigenen Land habe ich ja gehabt. Und es ist nicht immer so, dass man wiederholte Ereignisse genauso toll wahrnimmt. Darum trauere ich dem nicht nach. Ich möchte jetzt meine internationalen Kontakte weiter bespielen und intensivieren. Das reizt mich. Meine Entscheidung muss zudem nicht heißen, dass ich für die Europameisterschaft ganz ohne Beschäftigung bin.
Frage: Was nehmen Sie mit aus der Zeit als Nationalmannschaftsarzt?
Antwort: Als Erstes bin ich dem DFB dankbar für diese Zeit. Nicht jeder hat die Chance, diese Funktion auszuüben. Ich habe tolle Dinge erlebt. Natürlich steht ganz oben die WM in Brasilien, insbesondere weil wir sie gewonnen haben. Es war aber auch ein besonderer Rahmen in Südamerika. Jeder sah die Bedingungen als sehr schwierig an, es hieß gar, ein europäisches Team könne auf dem Kontinent nicht gewinnen. Auch die medizinischen Herausforderungen waren größer als bei den anderen Turnieren. Bei keinem Turnier davor und danach war ich als Arzt so involviert in die gesamte Vorbereitung wie 2014.
Frage: Und ansonsten?
Antwort: Ich kann sagen, dass ich wirklich Glück gehabt habe mit den Turnieren. Mein erstes war gleich weit weg in Japan und Südkorea. Das war für mich als junger Arzt sehr spannend. Die Heim-WM danach war sehr emotional geprägt. Die gesamte deutsche Bevölkerung hat das Turnier mitgetragen. In Südafrika 2010 ist die Mannschaft geboren worden, die vier Jahre später Weltmeister wurde – ein unheimlich dynamisches Turnier für uns mit tollen Spielen. Und auch nach 2014 wurde es nicht gleich schlecht. 2016 hätten wir eigentlich Europameister werden müssen. 2017 wurde dann noch mit einem Nachwuchsteam der Confed Cup gewonnen. Danach wurde es leider sportlich schlechter.
Frage: Sie waren nicht der Teamarzt, der bei Länderspielen zu den verletzten Spielern auf den Platz eilte. Kann man sagen, Sie waren eher der Arzt im Hintergrund, der für die Mannschaftsapotheke, für das Anti-Doping-Management und die Leistungsdiagnostik?
Antwort: So kann man das etwa sagen. Meine Zuständigkeit war klassisch „sportmedizinisch-allgemeinmedizinisch“. Auf dem Spielfeld habe ich wirklich selten einen Einsatz gehabt. Als vor vielen Jahren mein orthopädischer Kollege mal mit einem anderen Spieler in der Kabine beschäftigt war, musste ich auf den Rasen laufen. Miroslav Klose war damals betroffen. Und er sagte dann: „Was machst Du denn hier?“ Ich war quasi für das Medical Management jenseits von Verletzungen zuständig und schreibe mir dabei auch auf die Fahnen, den einen oder anderen pseudomedizinischen Unsinn verhindert zu haben, der immer wieder an uns herangetragen wurde.
Frage: Wie meinen Sie das?
Antwort: Es ist für eine Nationalmannschaft nicht selten von Wert, eine klinisch-wissenschaftlich ausgewiesene Person dabei zu haben. So manche Kritik kommt dann gar nicht erst auf oder kann leichter gekontert werden. Der DFB-Tross bei Länderspielen besteht rund um die Mannschaft aber auch aus vielen Betreuern, die erkranken können und auch Vorerkrankungen mitbringen. Wir Mannschaftsärzte sind insofern nicht ausschließlich für die Versorgung der Spieler zuständig.
Frage: Sie haben vier Bundestrainer erlebt: Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und zuletzt Hansi Flick. Gab es Unterschiede? Hat sich Ihre Arbeit verändert?
Antwort: Natürlich waren diese Trainer sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber was sich am meisten verändert hat, waren die Spieler, deren Herkunft und Ausbildung. Ungefähr ab 2008 hatten diese fast alle die Nachwuchsakademien bei den Bundesligisten durchlaufen. Sie haben einen ganz anderen Lebensstil erlernt, der wesentlich sportgerechter ist als in früheren Zeiten. Aber auch Trainer haben immer großen Einfluss auf die Zusammenarbeit, keine Frage.
Frage: Inwiefern?
Antwort: Am längsten habe ich mit Jogi Löw zu tun gehabt. Rudi Völler war 2001 der Teamchef, der Trainer war formal ja Michael Skibbe. Beide haben es einem sehr einfach gemacht, sind ganz tolle Menschen. Jürgen Klinsmann bedeutete 2004 einen echten Bruch im Management der Nationalmannschaft. Er hat sehr gepuscht, auf grundlegende Veränderungen gedrängt. Und es kam sehr viel mehr Personal in das gesamte Team. Jürgen hat viele Innovationen auf den Weg gebracht, aber auch verschiedene Konflikte ausgelöst durch möglicherweise nicht immer beabsichtigte Kompetenzüberlappungen.
Frage: Joachim Löw war danach die Ewigkeit von 15 Jahren Bundestrainer. Wie war das?
Antwort: Ich habe Jogi unheimlich schätzen gelernt. Das Vertrauen, das er gegeben hat, war fürs Arbeiten brillant. Ich schätze ihn als Fußball-Fachmann, soweit ich das beurteilen kann, aber auch als Mensch und Organisator sehr. Jogi hatte wirklich eine ruhige Hand und konnte delegieren. Mit Hansi kam dann jemand zurück, den ich schon aus seiner Zeit als Jogis Assistent kannte, und den ich als Bindeglied zwischen Trainerstab, Betreuern und Spielern schätzen gelernt habe. Er kam 2021 in einer neuen Rolle zurück und hat zum Glück seine Empathie nicht abgelegt, obwohl das als verantwortlicher Trainer ja durchaus denkbar wäre.
Frage: War Corona die größte Herausforderung Ihrer Amtszeit? Sie wurden 2020 Leiter der medizinischen Taskforce für den sogenannten Sonderspielbetrieb und sind dadurch richtig bekannt geworden. Manch einer in der Fußballbranche rühmte Sie als Retter des Profifußballs in Deutschland.
Antwort: Es war auf jeden Fall – auch durch die öffentlichen Diskussionen – die belastendste Zeit meiner bisherigen Tätigkeit im Fußball. Corona betraf nicht nur die Nationalmannschaft, sondern den deutschen Fußball und auch die UEFA, bei der ich Vorsitzender der Medizinischen Kommission bin. Da entstand schon ein großer Druck. Es war als Teamarzt auch die nervigste Zeit, weil man viele Dinge nicht beeinflussen konnte. Plötzlich tauchten Spieler auf, die bei Anreise oder wenige Tage später positiv getestet wurden. Und schon ist man als Arzt mittendrin in einem riesigen Trubel von Abstrichen und Kontaktvermeidungen. Da bekommt man schon gelegentlich ein ohnmächtiges Gefühl. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dachte ich im Teamhotel dann: Hoffentlich wacht morgen früh keiner auf und fängt an zu husten.
Frage: Wie wird es sein für Sie, wenn nach so langer Zeit Ende März die ersten Länderspiele ohne Sie auf der deutschen Bank stattfinden? Werden Sie dann Fernsehzuschauer sein? Oder sogar im Stadion?
Antwort: Das weiß ich noch nicht. Das Gefühl wird sicherlich etwas komisch sein, wenn ich vorm Fernseher sitzen sollte. Aber irgendwann muss man den Schritt eben vollziehen. Und es ist doch angenehm, wenn man den Zeitpunkt selbst bestimmt. Was ich sicherlich vermissen werde, wird das Gemeinsame im Kreise der Betreuer sein. Es sind immer noch Menschen dabei wie Physiotherapeut Wolfgang Bunz, TV-Experte Uli Voigt oder Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann, mit denen ich zwei Jahrzehnte zusammengearbeitet habe. Die gemeinsamen Abende nach getaner Arbeit und die Diskussionen über das letzte oder nächste Spiel, ja, das werde ich vermissen.
Zur Person: Tim Meyer, geboren am 30. Oktober 1967 in Nienburg (Niedersachsen), studierte Medizin und Sport in Hannover und Göttingen. Von 2001 bis zur WM 2022 in Katar war er Arzt der Nationalmannschaft. Er ist Ärztlicher Leiter des Instituts für Sport- und Präventivmedizin der Universität Saarland in Saarbrücken. Er steht unter anderem den Medizinischen Kommissionen des DFB und der UEFA vor.