In der Werbung sind Rabattaktionen und Bestpreisgarantien weit verbreitet. Was Händler dürfen, wo sie tricksen – und wie eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs nun mehr Klarheit schaffen könnte.
Rabatt, Bonus, Bestpreis – Wie Händler damit werben dürfen
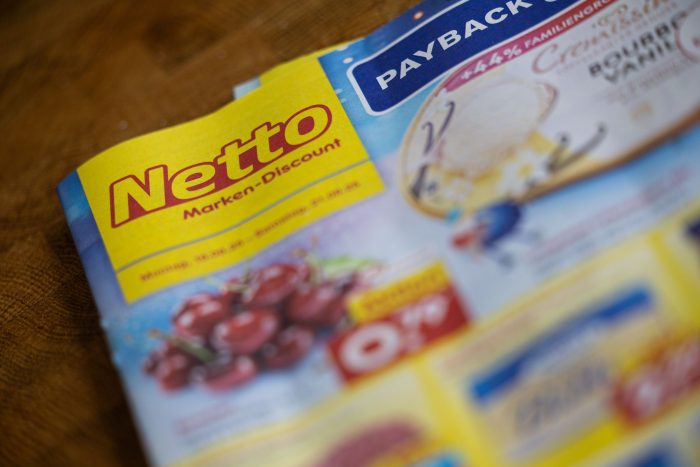
Beim Einkaufen ist der Preis oft das entscheidende Argument, wenn Kundinnen und Kunden zwischen verschiedenen Produkten wählen können. Aus diesem Grund werben viele Unternehmen mit Rabattaktionen, Bonusprämien oder Bestpreisgarantien für ihre Produkte. Wer jedoch mit Preisnachlässen locken möchte, muss rechtlich einiges berücksichtigen.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich zuletzt mit dem Thema befasst. Heute wird das oberste deutsche Zivilgericht in Karlsruhe seine Entscheidung in einem Rechtsstreit über eine Kaffee-Werbung des Lebensmitteldiscounters Netto bekannt geben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Rechtslage:
Welcher Preis wird ausgeschrieben?
Die Preisangabenverordnung regelt, wie Unternehmen die Preise ihrer Waren oder Leistungen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern angeben müssen. Laut Gesetz muss der Gesamtpreis genannt werden, also der Betrag, den Kunden pro Ware oder Leistung einschließlich Umsatzsteuer und anderer Preisbestandteile zahlen müssen.
Des Weiteren müssen Händler teilweise den Grundpreis angeben. Dies ist der Preis pro Mengeneinheit: pro Kilo, Liter, Kubikmeter, Meter oder Quadratmeter. Diese Regelung gilt für alle Produkte, die in Fertigverpackungen, offenen Verpackungen oder Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden – also beispielsweise Lebensmittel, Blumenerde oder Stoffe. Der Preis muss eindeutig, gut erkennbar und gut lesbar sein.
Was gilt bei Preisrabatten?
Bei der Werbung mit Preisherabsetzungen gilt grundsätzlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch nicht in die Irre geführt werden dürfen, erklärt Rechtsanwalt Martin Jaschinski von der Berliner Kanzlei JBB Rechtsanwälte. Das sei zum Beispiel dann der Fall, wenn mit falschen Ursprungspreisen verglichen wird, die nie so hoch waren wie behauptet. «Das passiert gar nicht mal so selten», sagt der Werberechtsexperte.
Eine weitere Werbestrategie sei die Preisschaukel, bei der das Unternehmen den Preis für eine kurze Zeit hochsetzt, um danach mit einem vermeintlichen Rabatt zu werben. Auch dem setze das Wettbewerbsrecht enge Schranken: Wer nur für eine «unangemessen kurze Zeit» den höheren Preis verlange, dürfe danach nicht mit einer Preisherabsetzung werben, sagt Jaschinski. Aber wie definiert man eine solche unangemessen kurze Zeit? Und wie können Wettbewerber oder Verbraucherschützer das nachverfolgen?
Mit welchem Preis wird verglichen?
Um diesen praktischen Problemen entgegenzuwirken, hat die Europäische Union (EU) beschlossen, dass bei jeder Werbung mit einer Preisermäßigung immer der niedrigste Preis angegeben werden muss, der in einem Zeitraum von 30 Tagen vor dieser Preisermäßigung für das Produkt verlangt wurde – der sogenannte Referenzpreis. In Deutschland wurde diese europäische Richtlinie in der Preisangabenverordnung umgesetzt.
Wie muss dieser Preis angegeben werden?
Juristisch umstritten war zunächst, wie und wo dieser 30-Tage-Referenzpreis angegeben werden muss, sagt Fachmann Jaschinski. Im September schaffte der Europäische Gerichtshof dann Klarheit: Die Luxemburger Richterinnen und Richter entschieden, dass sich prozentuale Rabatte oder Werbeaussagen wie «Preis-Highlight» immer auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage beziehen müssen. Es reicht also nicht, den Referenzpreis etwa in einer Fußnote zu nennen, sich sonst aber auf einen höheren Preis zu beziehen.
Worüber entscheidet nun der BGH?
Im Juni hat der BGH über eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen den Lebensmitteleinzelhändler Netto Marken-Discount mit Sitz in Maxhütte-Haidhof, Bayern, verhandelt – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Discounter mit einem Hund im Logo, der hauptsächlich im Norden und Osten Deutschlands vertreten ist. Netto hatte für ein Kaffee-Produkt mit einem Preis von 6,99 Euro in der Vorwoche, einem aktuellen Preis von 4,44 Euro und einem Rabatt von -36 Prozent geworben. In einer Fußnote wurde auch der Referenzpreis von 4,44 Euro genannt, der genauso hoch war wie der vermeintlich reduzierte aktuelle Preis.
Wo liegt das Problem?
Die Werbung wird von der Wettbewerbszentrale als irreführend angesehen und als Verstoß gegen die Preisangabenverordnung betrachtet. „Im Grunde genommen sind zwei Fehler von Netto zu bemängeln“, erklärte Reiner Münker, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale, nach der Verhandlung in Karlsruhe. Einerseits hätte gemäß der Rechtsprechung des EuGH die Preisreduzierung in Prozent auf Grundlage des 30-Tage-Referenzpreises berechnet werden müssen. Andererseits sei die Darstellung der verschiedenen Angaben zu alten und neuen Preisen an sich für die Verbraucher zu schwer verständlich gewesen.
Welche Alternativen nutzen Unternehmen?
Infolge des EuGH-Urteils werde bereits etwas seltener mit Preisermäßigungen und dafür mehr mit unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) geworben, sagt Jaschinski. Es wird in der Werbung also nicht ein früherer Preis zum Vergleich herangezogen, sondern der Preis, den der Hersteller Händlern empfiehlt. Denn dafür gilt die Preisangabenverordnung nicht. «Ob sie das als UVP- oder als wirkliche Preisherabsetzung bewerben, ist für Verbraucher aber häufig gar nicht so leicht erkennbar», sagt der Berliner Anwalt. Und: Oftmals seien die UVP nicht seriös kalkuliert und lägen weit über den tatsächlichen Verkaufspreisen. «Da wird es noch viel Streitstoff geben», ist sich Jaschinski sicher.









