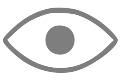Taubheitsgefühl breitet sich aus, keine Hilfe von Ärzten – Betroffener resigniert nach jahrelanger Odyssee.
Verzweifelte Suche nach Diagnose bei seltener Krankheit

Vor etwa zehn Jahren begann alles. Bernward Wittschier hatte taube Finger, taube Zehen und ein taubes Gesicht. Außerdem schmeckte plötzlich alles nur noch salzig. Heute hat sich das Taubheitsgefühl weiter ausgebreitet: Es zieht sich von der Stirn schräg über seinen Kopf nach unten bis in den Schulterbereich.
«Es ist, wie wenn man zehn Betäubungsspitzen beim Zahnarzt bekommt und die Wirkung nie nachlässt», sagte der 63-Jährige in Trier. Die Taubheit schlage inzwischen auch auf das Sprechen und das Schlucken: «Ich verschlucke mich 30- bis 40-mal am Tag.» Er habe Angst, dass die Krankheit weiterwandere.
«Ratlos und verzweifelt»
Das Allerschlimmste sei aber: «Mir kann kein Arzt helfen.» Er habe eine wahre «Behandlungsmühle» hinter sich. Vom Hausarzt, Gehirnspezialisten über Lungenfacharzt, Zahnarzt und Orthopäden – bis er sich ans Zentrum für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg wandte.
Dort sei auch er mehrfach stationär in der Neurologie gewesen – ohne dass bisher eine klare Diagnose oder Therapie gefunden werden konnte, sagte der Rechtsanwalt. «Ich bin ratlos und auch ein Stück weit verzweifelt.»
Diagnose kann viele Jahre dauern
Die schwierige und langwierige Suche nach einer Diagnose ist den Experten des Zentrums für seltene Erkrankungen in Homburg bekannt. «Im Schnitt kann das bis zu fünf Jahre dauern», sagte die Geschäftsführerin und Lotsin des Zentrums, Katarzyna Rososinska. In Extremfällen wisse man erst nach vielen Jahren, sogar 25 Jahren, an was jemand leide.
Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar
Oft werde auch eine Fehldiagnose gestellt. Und: «Leider findet man nicht immer eine Diagnose. Es gibt Fälle, da stößt man diagnostisch einfach an Grenzen», sagte die Oberärztin.
Der Tag der seltenen Erkrankungen fällt in diesem Jahr auf den 28. Februar. In Schaltjahren ist er am 29. Februar. Wenn es bis zu 5 Fälle pro 10.000 Einwohner gibt, spricht man von einer solchen Erkrankung“, sagte sie. In Europa gibt es etwa 30 Millionen Betroffene, in Deutschland sind es 4 Millionen Menschen. Es gibt auch noch ultraseltene Erkrankungen, die weniger als 2 pro 100.000 Einwohnern betreffen.
Immer mehr seltene Erkrankungen
Inzwischen sind laut Rososinska rund 8.000 seltene Erkrankungen bekannt. «Es kommen immer neue dazu», sagte sie. Das liege auch daran, dass immer mehr genetische Untersuchungen gemacht würden, die dann mit Symptomen und Krankheitsbildern zusammengebracht würden. Zudem wachse – auch politisch gewollt – das Interesse an den seltenen Erkrankungen.
An Universitätskliniken im ganzen Land gibt es 36 Zentren für seltene Erkrankungen, erklärte die Ärztin. Diese Zentren sind miteinander vernetzt und tauschen Informationen aus. Man verweist auch Fälle an andere Experten, wenn diese bekannt sind.
Zentrum hilft bei rund einem Drittel
Patienten, die Schwierigkeiten bei der Diagnose ihrer Krankheit haben, wenden sich an das Zentrum in Homburg, so der Sprecher Robert Bals. Nach Prüfung der Unterlagen werden Verdachtsfälle auf seltene Erkrankungen mit Fachkollegen der Uniklinik besprochen und entsprechend auf Fachbereiche wie Neurologie, Orthopädie oder Kinderklinik verteilt.
Im Durchschnitt gibt es rund 70 Anfragen pro Jahr an das Zentrum. In etwa einem Drittel der Fälle kann bei der Diagnose geholfen werden, sagte der Professor für Innere Medizin und Pneumologie. Bei den restlichen stellt sich heraus, dass es sich nicht um eine seltene Erkrankung handelt – oder die Diagnosefindung zieht sich hin.
Die Patienten in Homburg kommen nicht nur aus dem Saarland, sondern auch aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Luxemburg. In Spezialambulanzen werden am Uniklinikum jährlich viele Patienten behandelt, bei denen bereits eine Diagnose vorliegt. Etwa 3.000 Fälle werden stationär behandelt.
Bei der Suche «Dranbleiben»
Laut Bals, der das Zentrum im Jahr 2016 mitgegründet hat, gibt es bei seltenen Erkrankungen kaum Therapien und Medikamente aufgrund der geringen Fallzahlen. Nur drei Prozent dieser Erkrankungen haben in Deutschland zugelassene Medikamente zur Verfügung.
Rososinska sagte, man solle als Patient bei der Suche nach der Diagnose «dranbleiben». Es könne sein, dass irgendwann ein neues Symptom dazukomme, das dann zur Klärung beitragen könnte. Sie selbst habe solche Fälle schon erlebt, sagte die 48-Jährige.
Patient Wittschier hat vieles versucht
Bernward Wittschier dagegen ist nach all den Jahren Suche resigniert. «Ich habe alle Untersuchungen, die man machen kann, schon zigmal gemacht», sagte er. Lumbalpunktion, Röhre, Nerventests. «Man hatte bei mir schon so viele Verdachtsdiagnosen: Gehirntumor, Alzheimer, Multiple Sklerose. War aber alles nichts.» Er habe auch sonst vieles versucht: Spritzen, Cortison, Homöopathie.
Ein Gehirnspezialist habe zu ihm gesagt: «Herr Wittschier, dass Sie eine deutliche Erkrankung haben, kann ich feststellen. Sie sind wahrscheinlich einer von 10, 20 oder 30 Leuten in Deutschland, die so etwas haben. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wo sie herkommt.»
Stiftung fördert Forschung
Seit 2006 setzt sich die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für eine bessere medizinische Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit seltenen Erkrankungen ein. Vor allem die Forschungsförderung ist der Stiftung ein Anliegen. «Mangels Forschung fehlen wirksame Behandlungsansätze und Medikamente», teilte die Stiftung mit.
Die Krankheiten können genetischer, infektiöser oder Umweltursprung sein. 70 Prozent treten im Kindesalter auf, während andere sich erst später entwickeln.
Die Idee zur Stiftung entstand in der Familie des früheren Bundespräsidenten, weil man vieles aus eigener Erfahrung kannte: «die verzweifelte Suche nach Antworten» und «die jahrelange Odyssee von Klinik zu Klinik» – und die «Hilflosigkeit angesichts fehlender Behandlungsoptionen».
Die Tochter von ihnen leidet an einer seltenen Augenkrankheit, die zur Erblindung geführt hat. Experten schätzen laut Stiftung, dass jedes Jahr bis zu 250 neue seltene Erkrankungen entdeckt werden.
Wunsch nach einem ganz normalen Tag
Wittschier sagte, er hoffe, dass eines Tages jemand erkenne, was er habe. Oder wenigstens eine Ahnung oder Idee habe, was es sein könnte. Sein größter Wunsch sei: «Einen Tag mal wieder ganz normal zu erleben wie vor 20 Jahren. An dem ich alles spüre und schmecke.»