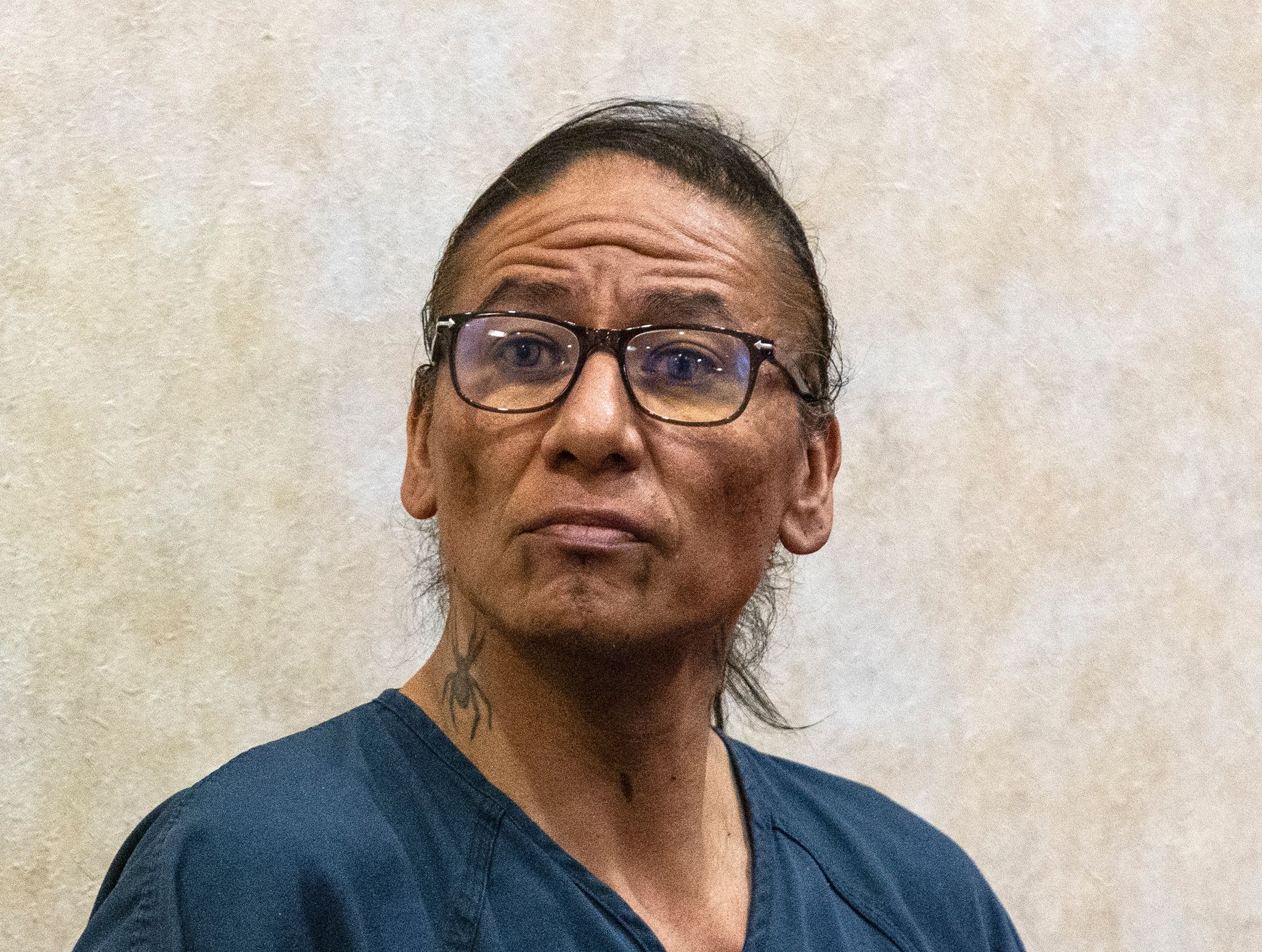Stottern ist eine Störung des Redeflusses, die durch genetische Veranlagung beeinflusst wird. Therapiemöglichkeiten umfassen Stottermodifikation und Fluency Shaping.
Stottern: Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten

Etwa ein Prozent der Bevölkerung leidet unter Stottern – ungefähr viermal so viele Männer wie Frauen. Laut der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe (BVSS) sind in Deutschland mehr als 830.000 Menschen von dieser Sprachstörung betroffen. Doch was genau ist Stottern, was sind die Ursachen und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Welttag des Stotterns am 22. Oktober:
Was ist Stottern?
Stottern ist eine Beeinträchtigung des Sprechflusses. «Wer stottert, weiß genau, was er sagen möchte, kann es in dem Moment jedoch nicht störungsfrei aussprechen», schreibt die Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe. In Deutschland wird Stottern als Behinderung anerkannt. Betroffene Kinder können beispielsweise einen Nachteilsausgleich in der Schule beantragen.
Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Stottern. Die sogenannten Kernsymptome sind:
- das Wiederholen von Lauten und Silben
- das Dehnen einzelner Laute und
- Blockierungen vor oder in einem Wort.
Laut Stottertherapeutin Claudia Walther aus Augsburg sei das Hauptproblem für stotternde Menschen oft der Übergang zum Vokal, zum Beispiel nach einem Konsonanten. Sie erklärt, dass Begleitsymptome darin bestehen, dass Betroffene versuchen, diese Unterbrechungen im Sprechen durch erhöhte Anstrengung zu überwinden oder bestimmte Wörter zu umgehen.
Woher kommt Stottern?
Laut Experten ist Stottern hauptsächlich genetisch veranlagt. «Es ist aber so: Man hat immer versucht, die Gene zu suchen, die dafür verantwortlich sind. Das hat nicht funktioniert», sagt der Neurologe Martin Sommer vom Universitätsklinikum Göttingen.
Eine kürzlich im Fachblatt «Nature Genetics» veröffentlichte Studie verweist auf 57 Genorte – zugeordnet zu 48 Genen -, die mit Stottern verbunden sind. Dennoch: «Niemand versteht wirklich, warum jemand stottert. Es ist ein völliges Rätsel», betonte Studienleiterin Jennifer Below vom Vanderbilt University Medical Center in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee).
Basis für die Studie waren demnach die Daten von knapp 100.000 Betroffenen. Auf die Frage: «Haben Sie jemals gestottert oder gestammelt?» hatten sie mit «ja» geantwortet. Zum Vergleich zogen die Wissenschaftler die Daten von mehr als einer Million Menschen heran, die die Frage mit «Nein» beantwortet hatten. Der Neurologe Sommer kritisiert die Datenbasis, weil er die Frage für zu allgemein hält.
Laut dem Experten unterscheidet sich bei stotternden Menschen ein Areal in der linken Gehirnhälfte von anderen Personen. «Das ist eine Stelle mit reduzierter Faserintegrität», erläutert Sommer, der selbst stottert. «Dort funktionieren sozusagen die Hirnfasern, die die verschiedenen grauen Zellen miteinander verknüpfen, nicht so gut wie bei den flüssig sprechenden Menschen.»
Wann sollten Betroffene Hilfe suchen?
Meist entsteht Stottern im Alter von zwei bis sechs Jahren. «Eine Therapie ist auf jeden Fall indiziert, wenn das Kind sich in irgendeiner Form anstrengt», sagt Stottertherapeutin Walther. «Wenn es zum Beispiel merkt, das geht jetzt nicht, und dann anfängt, den Kopf mitzubewegen, lauter zu werden, die Silben, die Laute rauszupressen.»
Wenn das Kind sich schämt, sich zurückzieht und weniger Lust hat zu sprechen, ist es ratsam, dass Eltern sich von einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt beraten lassen.
Wie lässt sich Stottern behandeln?
Betroffene haben die Möglichkeit, ihr Stottern in einer logopädischen Therapie zu verändern. Die sogenannte Stottermodifikation zielt darauf ab, das Stottern zu verändern, indem das Sprechen im Moment des Stotterns angehalten und gezielt in einen Vokal übergegangen wird.
Bei dem sogenannten Fluency Shaping geht es dagegen darum, den Sprachfluss abzuwandeln. «Das heißt, ich nutze Techniken, um das Sprechen an sich zu verändern», sagt Walther. Dabei werde beispielsweise das Sprechen gedehnt, um den Redefluss zu erhöhen.
Walther zufolge ist die Bearbeitung von möglicherweise entstandenen Ängsten beim Sprechen ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Stottertherapie.